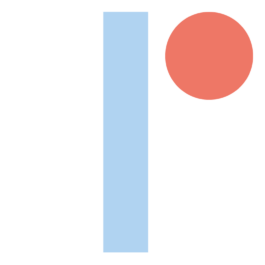
Psychosomatik
I
Zu Beginn möchte ich mich der Problematik des Verhältnisses zwischen Leib und Seele widmen, das historisch betrachtet kontrovers diskutiert beziehungsweise verstanden wurde. Während Freud darauf hinweist, dass das Ich zuallererst ein Körperliches ist und Philosophen sich schon früh mit den Fragen rund um die Unterscheidung zwischen Soma und Psyche beschäftigt haben, so unklar und rätselhaft blieb und bleibt es doch. Die Frage nach Leib und Seele und wer von beiden wen gefangen hält, führt bereits zu Platon und Aristoteles. Überraschend finde ich in den philosophischen Betrachtungen, die so häufig nachzulesenden Bemühungen hier das eine vom anderen so dringend trennen zu wollen oder zumindest die offenbar angenommene unterschiedliche Qualität der beiden zu thematisieren. Marzano schreibt in kritischer Bezugnahme auf die großen Werke Homers, der Ilias und der Odyssee: „Das Ich und sein Körper sind sich einig, draußen und drinnen, Oberfläche und Tiefe, Inneres und Äußeres überlagern sich ständig“.
Schafft man von dieser Aussage einen Bogen zur heutigen Haltung in der Medizin scheint es verwunderlich wie wenig von diesem Ansatz zu finden ist, wenngleich es bereits viele Bemühungen in Richtung psychosomatischer Medizin gibt. Die Frage nach dem „Wo es wehtut?“ scheint dennoch immer vordergründiger als die Frage „Warum es wehtut?“. Als ob es erst dann, wenn scheinbar keine physiologischen Antworten zu finden sind, die Idee einer psychischen Ursache zu keimen beginnt. So finden wir uns wieder in einer symptomfokussierten Medizin mit dem Bemühen so rasch als möglich Heilung an dieser Stelle herbeizuführen, wo es kritisch betrachtet, vielleicht keine Heilung braucht. Die Frage, um die sich an dieser Stelle die Psychotherapie kümmern muss ist, wie es gelingen kann Symptome im Wechselspiel von Soma und Psyche zu verstehen. Hierbei dient die Psychosomatik als Betrachtungsweise, die den Einfluss von körperlichen, seelischen und sozialen Bedingungen bei der Entstehung von Krankheiten und bei deren Behandlung versucht zu verstehen. Mit dem Verstehen geht der Anspruch oder vielmehr der Wunsch einher mittels Psychotherapie buchstäblich, eine andere Sprache für psychische Konflikte als die der Somatisierung zu finden. Schon bei Josef Breuer und Sigmund Freud tauchen diesbezüglich im Fall von Bertha Pappenheim, die in den Fallstudien zur Hysterie unter dem Pseudonym bekannt gewordene Anna O., die Begriffe „talking cure“ (Redekur) und „chimney sweeping“ (Schornsteinfegen) auf. Dies bringt in der Geschichte der Psychoanalyse einen ersten Hinweis, dass mit Hilfe des Sprechens in der Therapie Einfluss auf den Körper genommen werden kann.
Doch blickt man noch weiter zurück, kommt man wieder nicht um die großen Philosophen umher. So meinte Sokrates, es sei das größte Unglück, dass es bei der Behandlung von Kranken Ärzte für den Körper gibt und Ärzte für die Seele: „… so wie man nicht unternehmen dürfe, die Augen zu heilen ohne den Kopf, noch den Kopf ohne den ganzen Leib, so auch nicht den Leib ohne die Seele, sondern dieses eben wäre auch die Ursache, weshalb die Ärzte den meisten Krankheiten noch nicht gewachsen wären, weil sie nämlich das Ganze verkennen“ (Sokrates in Plato ( 428-348 v-Chr.) Charmides).
So alt wie diese Erkenntnisse aus heutiger Sicht sind, so unverstanden scheinen sie blickt man auf subjektive und wissenschaftliche Krankheitstheorien im Laufe der Geschichte und zum heutigen vorrangigen Verständnis in der Medizin. Weizecker appelliert daran nicht dem körperlichen weniger, sondern dem Seelischen und Sozialen mehr Beachtung zu schenken.
Wie kann das aber gelingen, wenn der erste Weg eines Kranken zum Arzt führt und er dort meist innerhalb von fünf Minuten abgehandelt wird? So gleich wird der Ruf nach mehr Zeit deutlich hörbar. Denn wenn es Verstehen braucht, um auf die richtige Spur zu kommen, dann braucht es auch Zeit. Jedoch gilt in einer ökonomisierten Gesellschaft nach wie vor der Leitgedanke „Zeit ist Geld“. Es scheint beinahe trivial und absurd wie kurzgedacht dieser Blick auf die Thematik ist, denn ein kranker Mensch kostet.
Die Verführung hier den Wert des Menschen anhand von Zahlen und Kosten zu berechnen, oder anhand dessen die angemessene Behandlung zu wählen (selbst wenn sie langfristig günstiger käme), kann nicht Intention einer Psychotherapie und vor allem nicht die einer Psychoanalyse sein. Hier soll es vielmehr darum gehen, den Einzelnen konkret in den Blick zu nehmen und ein gemeinsames Verstehen voranzutreiben. Wie Freud es auszudrücken vermochte „Wo Es war soll Ich werden“ oder das Bemühen „neurotisches Elend in menschliches Unglück“ zu verwandeln. So trist dies im ersten Moment klingt, so ist es doch als zutiefst befreiender Akt zu verstehen, der keinen anderen Anspruch erhebt als den der Wahrheitssuche. Doch weiß man in der Psychoanalyse längst, dass es mit der „Wahrheit“ (die es nebstbei vielleicht auch nur subjektiv gibt) alleine nicht genügt und vor allem die Beziehung und die damit einhergehenden korrigierenden Erfahrungen eine Heilung bringen können. Dies kann jedoch nicht mit einem Rezept für ein Medikament erledigt werden, sondern braucht ein Gegenüber und Zeit.
Die Psychosomatik bringt hier einen Paradigmenwechsel im Verständnis von Gesundheit und Krankheit mit sich. Als Krankheitsursachen sind so neben körperlichen Neigungen und äußeren Belastungen auch die seelischen Neigungen und die inneren Belastungen gleichwertig. Es stellt sich nicht die Frage was vorrangig ist, sondern wie sich der Zusammenhang verstehen lässt. Dabei ist es zentral körperliche Befunde, soziale Einflüsse und seelische Erfahrungen in Beziehung zueinander zu setzen.
In der Psychosomatischen Medizin lässt sich hierbei das bio-psycho-soziale Modell von Thure von Uezküll nennen, das Wissensbereiche und Theorien miteinander verbindet, um so ein integriertes Behandlungskonzept nutzbar zu machen. Unter dem Credo Unterstützung statt Konkurrenz können verschiedene Fachbereiche miteinander kooperieren und zu einem Näherkommen an „das Ganze“ beitragen, wie es Sokrates es vielleicht meinte. In dieser Annäherung stellt sich die Frage welchen Part hierbei die Psychotherapie einnehmen kann. Wie bereits angedeutet steht hier die Beziehung im Sinne einer heilsamen Begegnung in der Krankheit im Zentrum. Hier ist es aus psychoanalytischer und therapeutischer Sicht wichtig, die in der Begegnung sichtbaren und vor allem spürbaren Phänomene und Dynamiken in einem Theoriekonzept einordnen zu können und so die Vorkommnisse entsprechend interpretieren zu können. Die Psychoanalyse gibt uns ein psychodynamisches Verständnis über die Konfliktbewältigung des Menschen und die Neurosenlehre welche als ein Teil zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit unabdingbar sind.
Im Gespräch über diese Thematik im Umfeld und in der eigenen persönlichen Auseinandersetzung wird spürbar, dass es in vielen Menschen doch ein Verständnis oder zumindest eine Ahnung darüber gibt in welch inniger Beziehung Körper und Seele stehen.
Jedoch kamen teils sehr verunsicherte Fragen darüber (obwohl ein Zusammenhang gesehen wurde), ob man bei diesem oder jenem Beispiel es wirklich für möglich halten würde, dass es einen psychosomatischen Zusammenhang gibt. In Betrachtung dieser Unsicherheit stieß ich wiederum auf die praktizierte Medizin, welche sich zumindest in diesen Beispielen, nur auf das Symptom fokussierte. Es gab seitens der Ärzte und Ärztinnen keine Fragen darüber wie sich der Kranke sein Kranksein subjektiv erklärte, oder darüber wie es um die momentane Situation bestellt sei. Betrachtet man den Menschen und seine Gesundheit anhand des bio-psycho-sozialen Modells von Thure von Uezküll könnte man es überspitzt formuliert als beinahe fahrlässig empfinden, wie einseitig man sich hierbei um den Menschen bemüht.
Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, im Zuge der Psychotherapie und der Psychosomatik den Menschen darin zu bestärken für sich selbst Erklärungen zu finden, die über das Symptom hinausgehen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für die Erhaltung und den Wiedergewinn von Gesundheit.
Literaturverzeichnis
Marzano, M. (2013): Philosophie des Körpers. München: Diederichs.
Storck, T. (2016): Psychoanalyse und Psychosomatik. Die leiblichen Grundlagen der Psychodynamik. Stuttgart: Kohlhmamer.
Kirchner, B. (2019): PP Folien zum Seminar Psychosomatik
Sokrates in Plato: Charmides/ Ch.Herrmann-Lingen, Marburg 2006
Mentzos, S. (2017): Lehrbuch der Psychodynamik. Die Funktion der Dysfunktionalität psychischer Störungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Psychosomatik
I
Ich möchte diese Seminararbeit dazu nutzen, mein Wissen im Themenfeld der „Psychoanalyse und Psychosomatik“ zu erweitern und zu festigen. Dahingehend werde ich interessante Überlegungen und Aspekte aufgreifen und zusammenfassen. Dies ist nicht als eine wissenschaftlich adäquate Abhandlung zu verstehen, jeodoch soll sich diese Arbeit darum bemühen, einen Einblick einerseits und einen groben Überblick andererseits über Themenfelder der Psychosomatik zu liefern.
Zu Beginn möchte ich mich der Problematik des Verhältnisses zwischen Leib und Seele widmen, das historisch betrachtet kontrovers diskutiert beziehungsweise verstanden wurde. Während Freud darauf hinweist, dass das Ich zuallererst ein Körperliches ist und Philosophen sich schon früh mit den Fragen rund um die Unterscheidung zwischen Soma und Psyche beschäftigt haben, so unklar und rätselhaft blieb und bleibt es doch. Die Frage nach Leib und Seele und wer von beiden wen gefangen hält, führt bereits zu Platon und Aristoteles. Überraschend finde ich in den philosophischen Betrachtungen, die so häufig nachzulesenden Bemühungen hier das eine vom anderen so dringend trennen zu wollen oder zumindest die offenbar angenommene unterschiedliche Qualität der beiden zu thematisieren. Marzano schreibt in kritischer Bezugnahme auf die großen Werke Homers, der Ilias und der Odyssee: „Das Ich und sein Körper sind sich einig, draußen und drinnen, Oberfläche und Tiefe, Inneres und Äußeres überlagern sich ständig“.
Schafft man von dieser Aussage einen Bogen zur heutigen Haltung in der Medizin scheint es verwunderlich wie wenig von diesem Ansatz zu finden ist, wenngleich es bereits viele Bemühungen in Richtung psychosomatischer Medizin gibt. Die Frage nach dem „Wo es wehtut?“ scheint dennoch immer vordergründiger als die Frage „Warum es wehtut?“. Als ob es erst dann, wenn scheinbar keine physiologischen Antworten zu finden sind, die Idee einer psychischen Ursache zu keimen beginnt. So finden wir uns wieder in einer symptomfokussierten Medizin mit dem Bemühen so rasch als möglich Heilung an dieser Stelle herbeizuführen, wo es kritisch betrachtet, vielleicht keine Heilung braucht. Die Frage, um die sich an dieser Stelle die Psychotherapie kümmern muss ist, wie es gelingen kann Symptome im Wechselspiel von Soma und Psyche zu verstehen. Hierbei dient die Psychosomatik als Betrachtungsweise, die den Einfluss von körperlichen, seelischen und sozialen Bedingungen bei der Entstehung von Krankheiten und bei deren Behandlung versucht zu verstehen. Mit dem Verstehen geht der Anspruch oder vielmehr der Wunsch einher mittels Psychotherapie buchstäblich, eine andere Sprache für psychische Konflikte als die der Somatisierung zu finden. Schon bei Josef Breuer und Sigmund Freud tauchen diesbezüglich im Fall von Bertha Pappenheim, die in den Fallstudien zur Hysterie unter dem Pseudonym bekannt gewordene Anna O., die Begriffe „talking cure“ (Redekur) und „chimney sweeping“ (Schornsteinfegen) auf. Dies bringt in der Geschichte der Psychoanalyse einen ersten Hinweis, dass mit Hilfe des Sprechens in der Therapie Einfluss auf den Körper genommen werden kann.
Doch blickt man noch weiter zurück, kommt man wieder nicht um die großen Philosophen umher. So meinte Sokrates, es sei das größte Unglück, dass es bei der Behandlung von Kranken Ärzte für den Körper gibt und Ärzte für die Seele: „… so wie man nicht unternehmen dürfe, die Augen zu heilen ohne den Kopf, noch den Kopf ohne den ganzen Leib, so auch nicht den Leib ohne die Seele, sondern dieses eben wäre auch die Ursache, weshalb die Ärzte den meisten Krankheiten noch nicht gewachsen wären, weil sie nämlich das Ganze verkennen“ (Sokrates in Plato ( 428-348 v-Chr.) Charmides).
So alt wie diese Erkenntnisse aus heutiger Sicht sind, so unverstanden scheinen sie blickt man auf subjektive und wissenschaftliche Krankheitstheorien im Laufe der Geschichte und zum heutigen vorrangigen Verständnis in der Medizin. Weizecker appelliert daran nicht dem körperlichen weniger, sondern dem Seelischen und Sozialen mehr Beachtung zu schenken.
Wie kann das aber gelingen, wenn der erste Weg eines Kranken zum Arzt führt und er dort meist innerhalb von fünf Minuten abgehandelt wird? So gleich wird der Ruf nach mehr Zeit deutlich hörbar. Denn wenn es Verstehen braucht, um auf die richtige Spur zu kommen, dann braucht es auch Zeit. Jedoch gilt in einer ökonomisierten Gesellschaft nach wie vor der Leitgedanke „Zeit ist Geld“. Es scheint beinahe trivial und absurd wie kurzgedacht dieser Blick auf die Thematik ist, denn ein kranker Mensch kostet.
Die Verführung hier den Wert des Menschen anhand von Zahlen und Kosten zu berechnen, oder anhand dessen die angemessene Behandlung zu wählen (selbst wenn sie langfristig günstiger käme), kann nicht Intention einer Psychotherapie und vor allem nicht die einer Psychoanalyse sein. Hier soll es vielmehr darum gehen, den Einzelnen konkret in den Blick zu nehmen und ein gemeinsames Verstehen voranzutreiben. Wie Freud es auszudrücken vermochte „Wo Es war soll Ich werden“ oder das Bemühen „neurotisches Elend in menschliches Unglück“ zu verwandeln. So trist dies im ersten Moment klingt, so ist es doch als zutiefst befreiender Akt zu verstehen, der keinen anderen Anspruch erhebt als den der Wahrheitssuche. Doch weiß man in der Psychoanalyse längst, dass es mit der „Wahrheit“ (die es nebstbei vielleicht auch nur subjektiv gibt) alleine nicht genügt und vor allem die Beziehung und die damit einhergehenden korrigierenden Erfahrungen eine Heilung bringen können. Dies kann jedoch nicht mit einem Rezept für ein Medikament erledigt werden, sondern braucht ein Gegenüber und Zeit.
Die Psychosomatik bringt hier einen Paradigmenwechsel im Verständnis von Gesundheit und Krankheit mit sich. Als Krankheitsursachen sind so neben körperlichen Neigungen und äußeren Belastungen auch die seelischen Neigungen und die inneren Belastungen gleichwertig. Es stellt sich nicht die Frage was vorrangig ist, sondern wie sich der Zusammenhang verstehen lässt. Dabei ist es zentral körperliche Befunde, soziale Einflüsse und seelische Erfahrungen in Beziehung zueinander zu setzen.
In der Psychosomatischen Medizin lässt sich hierbei das bio-psycho-soziale Modell von Thure von Uezküll nennen, das Wissensbereiche und Theorien miteinander verbindet, um so ein integriertes Behandlungskonzept nutzbar zu machen. Unter dem Credo Unterstützung statt Konkurrenz können verschiedene Fachbereiche miteinander kooperieren und zu einem Näherkommen an „das Ganze“ beitragen, wie es Sokrates es vielleicht meinte. In dieser Annäherung stellt sich die Frage welchen Part hierbei die Psychotherapie einnehmen kann. Wie bereits angedeutet steht hier die Beziehung im Sinne einer heilsamen Begegnung in der Krankheit im Zentrum. Hier ist es aus psychoanalytischer und therapeutischer Sicht wichtig, die in der Begegnung sichtbaren und vor allem spürbaren Phänomene und Dynamiken in einem Theoriekonzept einordnen zu können und so die Vorkommnisse entsprechend interpretieren zu können. Die Psychoanalyse gibt uns ein psychodynamisches Verständnis über die Konfliktbewältigung des Menschen und die Neurosenlehre welche als ein Teil zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit unabdingbar sind.
Im Gespräch über diese Thematik im Umfeld und in der eigenen persönlichen Auseinandersetzung wird spürbar, dass es in vielen Menschen doch ein Verständnis oder zumindest eine Ahnung darüber gibt in welch inniger Beziehung Körper und Seele stehen.
Jedoch kamen teils sehr verunsicherte Fragen darüber (obwohl ein Zusammenhang gesehen wurde), ob man bei diesem oder jenem Beispiel es wirklich für möglich halten würde, dass es einen psychosomatischen Zusammenhang gibt. In Betrachtung dieser Unsicherheit stieß ich wiederum auf die praktizierte Medizin, welche sich zumindest in diesen Beispielen, nur auf das Symptom fokussierte. Es gab seitens der Ärzte und Ärztinnen keine Fragen darüber wie sich der Kranke sein Kranksein subjektiv erklärte, oder darüber wie es um die momentane Situation bestellt sei. Betrachtet man den Menschen und seine Gesundheit anhand des bio-psycho-sozialen Modells von Thure von Uezküll könnte man es überspitzt formuliert als beinahe fahrlässig empfinden, wie einseitig man sich hierbei um den Menschen bemüht.
Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, im Zuge der Psychotherapie und der Psychosomatik den Menschen darin zu bestärken für sich selbst Erklärungen zu finden, die über das Symptom hinausgehen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für die Erhaltung und den Wiedergewinn von Gesundheit.
Literaturverzeichnis
Marzano, M. (2013): Philosophie des Körpers. München: Diederichs.
Storck, T. (2016): Psychoanalyse und Psychosomatik. Die leiblichen Grundlagen der Psychodynamik. Stuttgart: Kohlhmamer.
Kirchner, B. (2019): PP Folien zum Seminar Psychosomatik
Sokrates in Plato: Charmides/ Ch.Herrmann-Lingen, Marburg 2006
Mentzos, S. (2017): Lehrbuch der Psychodynamik. Die Funktion der Dysfunktionalität psychischer Störungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.