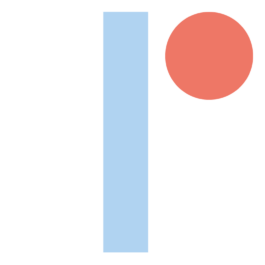
Good enough is good enough
Donald W. Winnicott – Good enough is good enough (vgl. Kruska, 2018)
Einige Bemerkungen zur Person Donald Woods Winnicott (1896-1971):

Stammt aus einer wohlhabenden Familie im Südwesten Englands; Vater führt ein Geschäft für Damenmieder; zwei ältere Schwestern; depressive Mutter; er wusste was es bedeutet, wenn Kinder unter Aufgabe der eigenen Bedürfnisse versuchen die emotional oder real abwesende Mutter zu halten

Gedicht: „Sein Leben sei gewesen,
seine Mutter zu beleben“

Winicotts Kindheit wird jedoch als
überwiegend glücklich beschrieben

Studium der Medizin (Kinderarzt) und danach Ausbildung zum
Psychoanalytiker; später Melanie Klein als Lehrerin und Supervisorin

Einzelgänger, der sich keiner spezifischen psychoanalytischen
Schule angeschlossen hat, er provoziert gerne; „entfant terrible“

Pionier der interaktiven Wende; Winnicott ordnet als Erster
intrapsychischeProzesse einer interpersonellen Perspektive unter

„there is no such
thing as a baby”

Winicott als Vermittler zwischen Anna Freud
und Melanie Klein; Middle Group

25 Jahre leitete Winnicott das Child Department
of the British Psychoanlytical Insitute
Winnicott meinte, dass Freud in seinen Theorien das Säuglingsalter vernachlässigt hatte und betonte die Bedeutung der Umwelt. Etwa vierzig Jahre beschäftigt er sich mit der menschlichen Entwicklung und dem Versuch des Babys aus der Abhängigkeit heraus zu einem Individuum mit eigener Persönlichkeit zu werden. Winnicott erkennt, dass der Säugling in erster Linie objektsuchend ist und nicht primär auf der Suche nach Spannungsreduktion. Er wird daher den Objektbeziehungstheoretikern zugeordnet, wobei er in vielen Punkten eine eigene Haltung einnimmt. Als bedeutendsten Ausgangspunkt seiner Theorien der emotionalen Entwicklung lässt sich das Konzept des sich entwickelnden Selbst nennen. Die Triebe versteht Winnicott im Gegensatz zu Freud eher im Dienste von Reifungsprozessen mithilfe derer sich der Säugling an die Realität anpasst, um ein erlebendes Wesen zu werden und eine Selbstbewusstheit zu entwickeln. Wachstum stellt hierbei einen grundlegenden Aspekt im Konzept des zentralen Selbst dar, welches das ererbte Potential in einer personalen psychischen Realität und einem personalen Körperschema in einer Kontinuität des Seins erlebt. Diese sperrige Beschreibung gibt einen Hinweis um was es sich beim „zentralen Selbst“ handeln könnte, jedoch bleibt der Begriff in der kognitiven Herangehensweise schwammig und schwer zu greifen. Persönlich finde ich Winnicott jedoch genau an diesem Punkt spannend, da es die Frage eröffnet, wo sich - wie in seinen weiteren Konzepten beschrieben - das wahre Selbst vom falschen Selbst abgrenzt und zu welchen Konflikten dies im Einzelfall führen kann.
Damit sich der Säugling gut entwickeln kann, orientiert er sich an der Umwelt. Mit dem Ausspruch „There is no such thing as a baby” wird deutlich, dass man in der ersten Zeit des Lebens sich nicht alleine verstehen kann, sondern nur in Verbindung mit der primären Bezugsperson. Hierbei beschreibt Winnicott die „primäre Mütterlichkeit“ als einen Zustand erhöhter Sensibilität in der sich die Mutter mit dem absolut abhängigen Baby identifiziert und dessen Bedürfnisse durch projektive Identifizierung erfühlen kann. Schon in der gedanklichen Auseinandersetzung lässt sich begreifen, welche Bedeutung diese Phase haben muss, bedenkt man die Abhängigkeit des Säuglings auf psychischer und physischer Ebene.
Hierbei lässt sich auch Wilfred Bions Konzept des Containing und dessen Funktion „unverdauliche“ Emotionen durch die Bezugsperson „verdaulich“ zu machen in aller Kürze erwähnen.
Man stelle sich aber vor wie fehleranfällig die Verbindung zwischen Mutter und Kind sein muss, bedenkt man neurotische oder gar psychotische Tendenzen oder schwierige Lebensumstände wie zum Beispiel Krankheit, konfliktreiche Paarbeziehungen, Armut, Trauma oder Ähnliches. Hierbei kommt jedoch glücklicherweise die „good enough“ / „hinreichend gute“ Mutter zur Geltung, die es schafft diesen Zustand der primären Mutterschaft zu erreichen und auch später wieder aufgeben kann. Damit ermöglicht sie es dem Säugling sich „wie angelegt“ zu entwickeln. Kommt es hierbei zu einem Versagen, erlebt das Baby diese schlechte Umwelt als Übergriff und die Seinskontinuität wird mit erheblichen Folgen gestört. „Nur durch die hinreichend gute Umgebung also wird dem Kind die Möglichkeit gegeben, überhaupt zu sein, zu erleben, ein persönliches Ich aufzubauen, Triebe zu beherrschen und den zum Leben gehörenden Schwierigkeiten zu begegnen" (Winnicott, 1958).
Winnicott definiert in der Entwicklung des Kindes drei Entwicklungsschritte, die absolute Abhängigkeit, die relative Abhängigkeit und die relative Unabhängigkeit. Dabei übernimmt die Mutter bzw. die primäre Bezugsperson unterschiedliche Funktionen.
Die absolute Abhängigkeit
Die Mutter hat die Funktion des „Haltens“ und stellt die noch fehlenden Ich-Funktionen zur Verfügung. Dadurch kann der Säugling die primärnarzisstische Illusion erhalten, dass er erschafft was er braucht (Erleben von Omnipotenz). Als Beispiel lässt sich der Hunger des Säuglings und das Stillen der Mutter heranziehen. Das Angebot der Mutter deckt sich mit dem Bedürfnis des Babys. Psychologisch betrachtet, gehört beim Stillen die Brust zum Selbst des Säuglings und der Säugling zum Selbst der nährenden Mutter. Dabei spielt der Blickkontakt zwischen Mutter und Kind eine wichtige Rolle, da das Baby durch den Blick der Mutter schließlich sich selbst erblickt und eine erste Ahnung von sich selbst bekommt.
Die relative Abhängigkeit
Der Übergang zum Stadium der relativen Abhängigkeit entspricht in etwa Freuds Ausführungen des Übergangs vom Lustprinzip zum Realitätsprinzip. Die völlige Anpassung der Mutter an das Kind nimmt in den ersten Lebenswochen ab, sodass das Kind die Kluft zwischen Phantasie und Realität überbrücken muss. Die Mutter muss dabei ein Feingefühl für das Maß an Versagung aufbringen, um dem Kind nur gerade so viel zuzumuten, wie es dieses verstehen und ertragen kann. Winnicott spricht hierbei vom „intermediären Bereich“ in dem das Kind sich die Illusion der Omnipotinz noch eine Weile erhalten kann, in dem der Säugling eine hinreichend gute Umwelt zu einer vollkommenen Umwelt verwandelt, um mit der kränkenden Realität fertig zu werden. Nach und nach wächst die Fähigkeit sich auf die Versagung einstellen zu können und so kann sich schrittweise die innere Realität in Abgrenzung zur äußeren Realität differenzieren. Das Kind begreift seine relative Abhängigkeit anzuerkennen und die Mutter als getrennt von sich zu verstehen. Ohne diesen schrittweisen Prozess der Versagung und der Desillusionierung würde sich die Entwicklung verzögern oder gestört werden.
Die relative Unabhängigkeit
In dieser Phase etwa zwischen dem vierten und zwölften Lebensmonat spielen Übergangsphänomene und Übergangsobjekte eine wichtige Rolle, welche der Angstabwehr dienen. Beispielsweise lässt sich als Übergangsphänomen das Greifen eines Babys nach einem äußeren Objekt wie der Decke beobachten, welche es sich gemeinsam mit dem Daumen in den Mund steckt, um daran zu nuckeln und dabei murmelt. Dieser selbstberuhigende Akt hat in dieser Phase eine lebensnotwendige Bedeutung. Die Eltern erkennen die Bedeutung von Übergangsobjekten (z.B. Schmusedecke, Kuscheltier, o.ä.) welche auf Reisen mitgenommen werden. Die Beziehung zu diesen weichen kuscheligen Objekten markieren den Beginn einer zärtlichen Objektbeziehung, welche die frühe Mutter-Kind-Beziehung repräsentieren. Dabei bekommt das Übergangsobjekt die Eigenschaften der Mutter, die es gerade braucht und muss auch stellvertretend für die Mutter alle liebevollen und positiven Gefühle wie auch alle aggressiven und negativen Gefühle aushalten.
Spannend finde ich vor dem Hintergrund der Objektbeziehungstheorien die Beobachtung von Säuglingen. Erst dadurch können einfache Handlungen in der Entwicklung komplex verstanden werden und geben einen Hinweis auf die eigentliche Bedürftigkeit des jungen Menschen und die Bedeutung der äußeren Welt. Umso tragischer ist es, wenn es hierbei zu starken Irritationen oder zu einem kalten Umfeld kommt. Die Psychotherapie kann dabei in der Beziehung zumindest ein Angebot und eine Atmosphäre dieser umsorgenden Resonanz auf die Bedürfnisse der Patienten schaffen, wenn gleich dies vielleicht weitere Herausforderungen mit sich bringt.
‚Wenn jedoch alles gut geht‘ kann der Prozess der Versagung schließlich ein Gewinn werden und es kann sich in der Auseinandersetzung mit der Objektwelt die Identität des Kindes herausbilden.
Das wahre und das falsche Selbst
Winnicott beschreibt in Bezug auf das Selbst eine normale Entwicklung, wenn wie erwähnt ‚alles gut geht‘ und eine fördernde Umwelt herrscht. Dann kann das Kind anfangen zu existieren und muss nicht bloß reagieren. In Bezug darauf betrachtet er Gesundheit als das Ergebnis einer hinreichend guten Umwelt am Beginn des Lebens. Das Gefühl innerer Lebendigkeit, Kreativität und Spontanität sind dabei zentrale Hinweise auf ein wahres Selbst, das sich in zwischenmenschlichen Beziehungen kooperativ, authentisch und kompromissbereit zeigen kann. In entscheidenden Situationen können Menschen mit wahrem Selbst bei sich bleiben und übernehmen oder fügen sich nicht einer Position eines anderen.
Das falsche Selbst bildet den gegenteiligen Part und ist nach Winnicott eine Art der Verzerrung des wahren Selbst wobei es Abstufungen von extrem bis gesund gibt. Hierbei herrschen Gefühle der Unwirklichkeit oder Nichtigkeit. Bei Säuglingen, die ein falsches Selbst ausbilden lässt sich eine allgemeine Reizbarkeit, Ernährungs- und Funktionsstörung erkennen. Das Kind ist isoliert, lebt nicht selbst und kopiert das Leben von anderen obwohl es mitunter normal scheint. Intelligente Kinder können das Denken als Ersatz für mütterliche Pflege und Anpassung verwenden und sich damit selbst bemuttern, es bildet sich dabei eine „Dissoziation zwischen intellektueller Aktivität und psychosomatischer Existenz“ heraus (Winnicott, 1965). Diese Symptome können sich später in psychischen Störungen oder in Schwierigkeiten bei zwischenmenschlichen Beziehungen zeigen.
Das wahre Selbst zu verbergen und zu beschützen, dient als Abwehrfunktion und ist der Zweck des falschen Selbst. Dies ist auch als Symptomgewinn des Kranken zu verstehen. Menschen mit falschem Selbst wirken als ob sie ständig eine Rolle spielen und verbergen wer sie wirklich sind. Ruhelosigkeit, Konzentrationsunfähigkeit und das Bedürfnis störende äußere Einflüsse auf sich zu beziehen und darauf zu reagieren, sind dabei wesentliche Aspekte des Lebens. Anstelle eigener Lebendigkeit wird versucht andere zu beleben.
Literaturverzeichnis
Kruska (2018): Donald W. Winnicott – Good enough is good enough! In: A. Sreck-Fischer (Hg.): Die frühe Entwicklung. Psychodynamische Entwicklungspsychologien von Freud bis heute. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Good enough is good enough
Donald W. Winnicott – Good enough is good enough (vgl. Kruska, 2018)
Einige Bemerkungen zur Person Donald Woods Winnicott (1896-1971):

Stammt aus einer wohlhabenden Familie im Südwesten Englands; Vater führt ein Geschäft für Damenmieder; zwei ältere Schwestern; depressive Mutter; er wusste was es bedeutet, wenn Kinder unter Aufgabe der eigenen Bedürfnisse versuchen die emotional oder real abwesende Mutter zu halten

Gedicht: „Sein Leben sei gewesen,
seine Mutter zu beleben“

Winicotts Kindheit wird jedoch als
überwiegend glücklich beschrieben

Studium der Medizin (Kinderarzt) und danach Ausbildung zum
Psychoanalytiker; später Melanie Klein als Lehrerin und Supervisorin

Einzelgänger, der sich keiner spezifischen psychoanalytischen
Schule angeschlossen hat, er provoziert gerne; „entfant terrible“

Pionier der interaktiven Wende; Winnicott ordnet als Erster
intrapsychischeProzesse einer interpersonellen Perspektive unter

„there is no such
thing as a baby”

Winicott als Vermittler zwischen Anna Freud
und Melanie Klein; Middle Group

25 Jahre leitete Winnicott das Child Department
of the British Psychoanlytical Insitute
Winnicott meinte, dass Freud in seinen Theorien das Säuglingsalter vernachlässigt hatte und betonte die Bedeutung der Umwelt. Etwa vierzig Jahre beschäftigt er sich mit der menschlichen Entwicklung und dem Versuch des Babys aus der Abhängigkeit heraus zu einem Individuum mit eigener Persönlichkeit zu werden. Winnicott erkennt, dass der Säugling in erster Linie objektsuchend ist und nicht primär auf der Suche nach Spannungsreduktion. Er wird daher den Objektbeziehungstheoretikern zugeordnet, wobei er in vielen Punkten eine eigene Haltung einnimmt. Als bedeutendsten Ausgangspunkt seiner Theorien der emotionalen Entwicklung lässt sich das Konzept des sich entwickelnden Selbst nennen. Die Triebe versteht Winnicott im Gegensatz zu Freud eher im Dienste von Reifungsprozessen mithilfe derer sich der Säugling an die Realität anpasst, um ein erlebendes Wesen zu werden und eine Selbstbewusstheit zu entwickeln. Wachstum stellt hierbei einen grundlegenden Aspekt im Konzept des zentralen Selbst dar, welches das ererbte Potential in einer personalen psychischen Realität und einem personalen Körperschema in einer Kontinuität des Seins erlebt. Diese sperrige Beschreibung gibt einen Hinweis um was es sich beim „zentralen Selbst“ handeln könnte, jedoch bleibt der Begriff in der kognitiven Herangehensweise schwammig und schwer zu greifen. Persönlich finde ich Winnicott jedoch genau an diesem Punkt spannend, da es die Frage eröffnet, wo sich - wie in seinen weiteren Konzepten beschrieben - das wahre Selbst vom falschen Selbst abgrenzt und zu welchen Konflikten dies im Einzelfall führen kann.
Damit sich der Säugling gut entwickeln kann, orientiert er sich an der Umwelt. Mit dem Ausspruch „There is no such thing as a baby” wird deutlich, dass man in der ersten Zeit des Lebens sich nicht alleine verstehen kann, sondern nur in Verbindung mit der primären Bezugsperson. Hierbei beschreibt Winnicott die „primäre Mütterlichkeit“ als einen Zustand erhöhter Sensibilität in der sich die Mutter mit dem absolut abhängigen Baby identifiziert und dessen Bedürfnisse durch projektive Identifizierung erfühlen kann. Schon in der gedanklichen Auseinandersetzung lässt sich begreifen, welche Bedeutung diese Phase haben muss, bedenkt man die Abhängigkeit des Säuglings auf psychischer und physischer Ebene.
Hierbei lässt sich auch Wilfred Bions Konzept des Containing und dessen Funktion „unverdauliche“ Emotionen durch die Bezugsperson „verdaulich“ zu machen in aller Kürze erwähnen.
Man stelle sich aber vor wie fehleranfällig die Verbindung zwischen Mutter und Kind sein muss, bedenkt man neurotische oder gar psychotische Tendenzen oder schwierige Lebensumstände wie zum Beispiel Krankheit, konfliktreiche Paarbeziehungen, Armut, Trauma oder Ähnliches. Hierbei kommt jedoch glücklicherweise die „good enough“ / „hinreichend gute“ Mutter zur Geltung, die es schafft diesen Zustand der primären Mutterschaft zu erreichen und auch später wieder aufgeben kann. Damit ermöglicht sie es dem Säugling sich „wie angelegt“ zu entwickeln. Kommt es hierbei zu einem Versagen, erlebt das Baby diese schlechte Umwelt als Übergriff und die Seinskontinuität wird mit erheblichen Folgen gestört. „Nur durch die hinreichend gute Umgebung also wird dem Kind die Möglichkeit gegeben, überhaupt zu sein, zu erleben, ein persönliches Ich aufzubauen, Triebe zu beherrschen und den zum Leben gehörenden Schwierigkeiten zu begegnen" (Winnicott, 1958).
Winnicott definiert in der Entwicklung des Kindes drei Entwicklungsschritte, die absolute Abhängigkeit, die relative Abhängigkeit und die relative Unabhängigkeit. Dabei übernimmt die Mutter bzw. die primäre Bezugsperson unterschiedliche Funktionen.
Die absolute Abhängigkeit
Die Mutter hat die Funktion des „Haltens“ und stellt die noch fehlenden Ich-Funktionen zur Verfügung. Dadurch kann der Säugling die primärnarzisstische Illusion erhalten, dass er erschafft was er braucht (Erleben von Omnipotenz). Als Beispiel lässt sich der Hunger des Säuglings und das Stillen der Mutter heranziehen. Das Angebot der Mutter deckt sich mit dem Bedürfnis des Babys. Psychologisch betrachtet, gehört beim Stillen die Brust zum Selbst des Säuglings und der Säugling zum Selbst der nährenden Mutter. Dabei spielt der Blickkontakt zwischen Mutter und Kind eine wichtige Rolle, da das Baby durch den Blick der Mutter schließlich sich selbst erblickt und eine erste Ahnung von sich selbst bekommt.
Die relative Abhängigkeit
Der Übergang zum Stadium der relativen Abhängigkeit entspricht in etwa Freuds Ausführungen des Übergangs vom Lustprinzip zum Realitätsprinzip. Die völlige Anpassung der Mutter an das Kind nimmt in den ersten Lebenswochen ab, sodass das Kind die Kluft zwischen Phantasie und Realität überbrücken muss. Die Mutter muss dabei ein Feingefühl für das Maß an Versagung aufbringen, um dem Kind nur gerade so viel zuzumuten, wie es dieses verstehen und ertragen kann. Winnicott spricht hierbei vom „intermediären Bereich“ in dem das Kind sich die Illusion der Omnipotinz noch eine Weile erhalten kann, in dem der Säugling eine hinreichend gute Umwelt zu einer vollkommenen Umwelt verwandelt, um mit der kränkenden Realität fertig zu werden. Nach und nach wächst die Fähigkeit sich auf die Versagung einstellen zu können und so kann sich schrittweise die innere Realität in Abgrenzung zur äußeren Realität differenzieren. Das Kind begreift seine relative Abhängigkeit anzuerkennen und die Mutter als getrennt von sich zu verstehen. Ohne diesen schrittweisen Prozess der Versagung und der Desillusionierung würde sich die Entwicklung verzögern oder gestört werden.
Die relative Unabhängigkeit
In dieser Phase etwa zwischen dem vierten und zwölften Lebensmonat spielen Übergangsphänomene und Übergangsobjekte eine wichtige Rolle, welche der Angstabwehr dienen. Beispielsweise lässt sich als Übergangsphänomen das Greifen eines Babys nach einem äußeren Objekt wie der Decke beobachten, welche es sich gemeinsam mit dem Daumen in den Mund steckt, um daran zu nuckeln und dabei murmelt. Dieser selbstberuhigende Akt hat in dieser Phase eine lebensnotwendige Bedeutung. Die Eltern erkennen die Bedeutung von Übergangsobjekten (z.B. Schmusedecke, Kuscheltier, o.ä.) welche auf Reisen mitgenommen werden. Die Beziehung zu diesen weichen kuscheligen Objekten markieren den Beginn einer zärtlichen Objektbeziehung, welche die frühe Mutter-Kind-Beziehung repräsentieren. Dabei bekommt das Übergangsobjekt die Eigenschaften der Mutter, die es gerade braucht und muss auch stellvertretend für die Mutter alle liebevollen und positiven Gefühle wie auch alle aggressiven und negativen Gefühle aushalten.
Spannend finde ich vor dem Hintergrund der Objektbeziehungstheorien die Beobachtung von Säuglingen. Erst dadurch können einfache Handlungen in der Entwicklung komplex verstanden werden und geben einen Hinweis auf die eigentliche Bedürftigkeit des jungen Menschen und die Bedeutung der äußeren Welt. Umso tragischer ist es, wenn es hierbei zu starken Irritationen oder zu einem kalten Umfeld kommt. Die Psychotherapie kann dabei in der Beziehung zumindest ein Angebot und eine Atmosphäre dieser umsorgenden Resonanz auf die Bedürfnisse der Patienten schaffen, wenn gleich dies vielleicht weitere Herausforderungen mit sich bringt.
‚Wenn jedoch alles gut geht‘ kann der Prozess der Versagung schließlich ein Gewinn werden und es kann sich in der Auseinandersetzung mit der Objektwelt die Identität des Kindes herausbilden.
Das wahre und das falsche Selbst
Winnicott beschreibt in Bezug auf das Selbst eine normale Entwicklung, wenn wie erwähnt ‚alles gut geht‘ und eine fördernde Umwelt herrscht. Dann kann das Kind anfangen zu existieren und muss nicht bloß reagieren. In Bezug darauf betrachtet er Gesundheit als das Ergebnis einer hinreichend guten Umwelt am Beginn des Lebens. Das Gefühl innerer Lebendigkeit, Kreativität und Spontanität sind dabei zentrale Hinweise auf ein wahres Selbst, das sich in zwischenmenschlichen Beziehungen kooperativ, authentisch und kompromissbereit zeigen kann. In entscheidenden Situationen können Menschen mit wahrem Selbst bei sich bleiben und übernehmen oder fügen sich nicht einer Position eines anderen.
Das falsche Selbst bildet den gegenteiligen Part und ist nach Winnicott eine Art der Verzerrung des wahren Selbst wobei es Abstufungen von extrem bis gesund gibt. Hierbei herrschen Gefühle der Unwirklichkeit oder Nichtigkeit. Bei Säuglingen, die ein falsches Selbst ausbilden lässt sich eine allgemeine Reizbarkeit, Ernährungs- und Funktionsstörung erkennen. Das Kind ist isoliert, lebt nicht selbst und kopiert das Leben von anderen obwohl es mitunter normal scheint. Intelligente Kinder können das Denken als Ersatz für mütterliche Pflege und Anpassung verwenden und sich damit selbst bemuttern, es bildet sich dabei eine „Dissoziation zwischen intellektueller Aktivität und psychosomatischer Existenz“ heraus (Winnicott, 1965). Diese Symptome können sich später in psychischen Störungen oder in Schwierigkeiten bei zwischenmenschlichen Beziehungen zeigen.
Das wahre Selbst zu verbergen und zu beschützen, dient als Abwehrfunktion und ist der Zweck des falschen Selbst. Dies ist auch als Symptomgewinn des Kranken zu verstehen. Menschen mit falschem Selbst wirken als ob sie ständig eine Rolle spielen und verbergen wer sie wirklich sind. Ruhelosigkeit, Konzentrationsunfähigkeit und das Bedürfnis störende äußere Einflüsse auf sich zu beziehen und darauf zu reagieren, sind dabei wesentliche Aspekte des Lebens. Anstelle eigener Lebendigkeit wird versucht andere zu beleben.
Besonders interessant finde ich den Aspekt, dass sich in diesem Kontext ADHS als ein Ausdruck der Entwicklung eines falschen Selbst verstehen lässt. Es zeigt sich eine Hyperaktivität mit großer Abhängigkeit von äußeren Reizen und dem Fehlen innerer Spielräume. Hierbei stellt sich für mich die Frage wie sich ein falsches Selbst in überangepasstem Verhalten ausdrücken kann, beziehungsweise in welch vielleicht versteckten Verhaltensweisen es sich noch finden lässt.
Fest steht wohl, dass die jeweilige Symptomatik etwas sehr Komplexes ausdrückt und im Einzelfall mit den Theorien im Hintergrund zu bewerten ist.
Literaturverzeichnis
Kruska (2018): Donald W. Winnicott – Good enough is good enough! In: A. Sreck-Fischer (Hg.): Die frühe Entwicklung. Psychodynamische Entwicklungspsychologien von Freud bis heute. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.